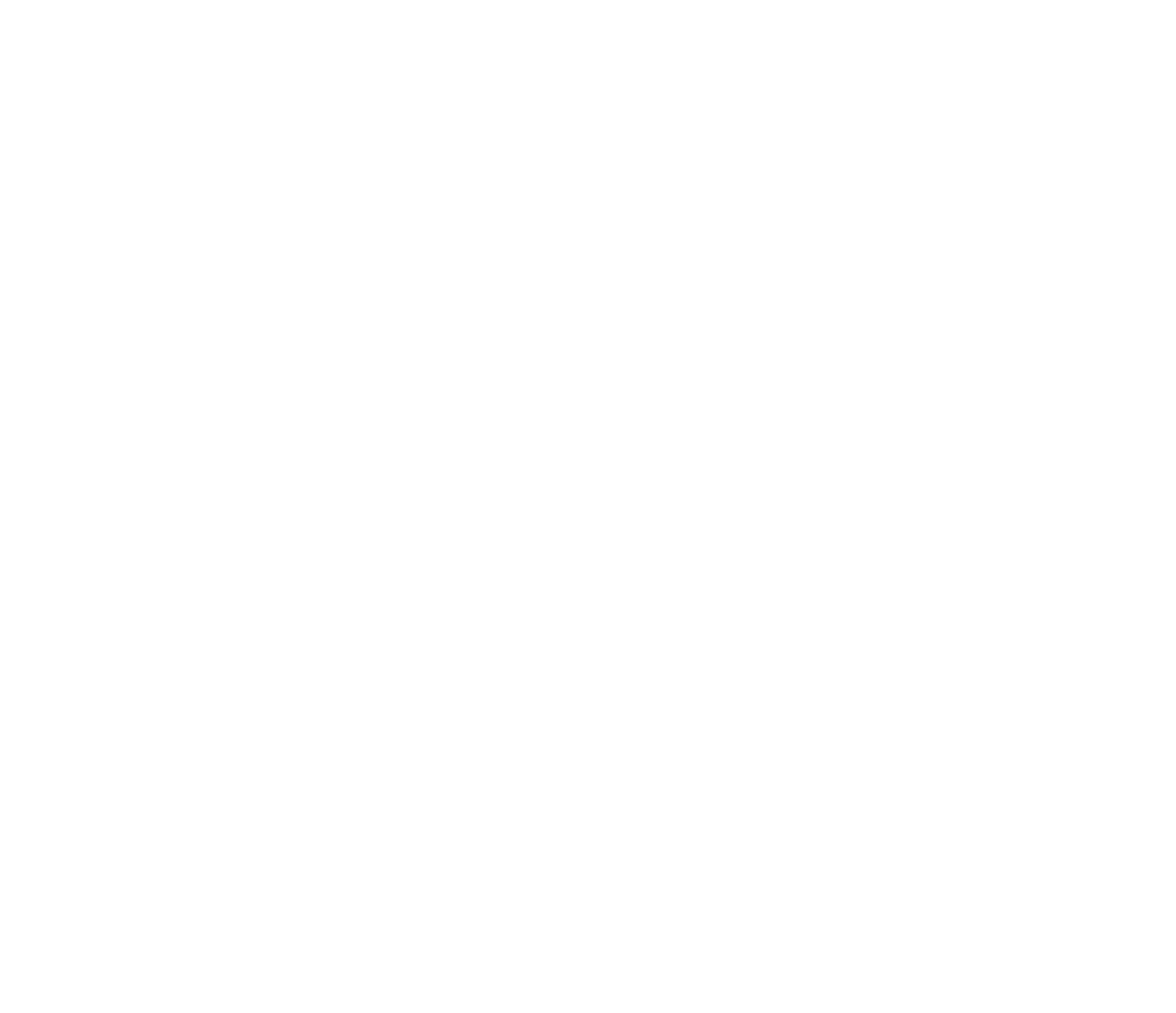POLLINOSE
Auch bekannt als Heuschnupfen oder Pollenallergie
Symptome, Ursachen und Empfehlungen zur Behandlung
Die Pollenallergie (auch Heuschnupfen oder Pollinose genannt) gehört zu den häufigsten allergischen Erkrankungen weltweit und weist eine ausgeprägte saisonale Abhängigkeit auf. Sie tritt auf, wenn das Immunsystem überempfindlich auf Pollen von Pflanzen reagiert – insbesondere bei wiederholtem Kontakt.
Der Begriff „Pollinose“ stammt vom lateinischen Wort pollen, was „Blütenstaub“ bedeutet – also genau der Stoff, der die Reaktion im Körper auslöst. Synonyme sind Heuschnupfen, Pollenallergie oder eben Pollinose.
In rund 95% der Fälle äußert sich die Pollinose durch:
Der Begriff „Pollinose“ stammt vom lateinischen Wort pollen, was „Blütenstaub“ bedeutet – also genau der Stoff, der die Reaktion im Körper auslöst. Synonyme sind Heuschnupfen, Pollenallergie oder eben Pollinose.
In rund 95% der Fälle äußert sich die Pollinose durch:
- allergische Rhinitis: laufende oder verstopfte Nase, starker Nasenausfluss, Juckreiz in Nase und Gaumen, anfallsartiges Niesen
- allergische Konjunktivitis: gerötete Augen, Juckreiz und Schwellung der Augenlider, Tränenfluss
📊 Wie viele Menschen sind betroffen?
Laut aktueller globaler Statistiken leiden bis zu 40% der Weltbevölkerung an allergischen Erkrankungen – mit einer Verdopplung der Fallzahlen etwa alle 10 Jahre.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass mittlerweile mehr als 50% der Europäer in irgendeiner Form von Allergien betroffen sind. Allergische Erkrankungen könnten im Laufe des 21. Jahrhunderts weltweit zur zweithäufigsten Krankheitsgruppe nach psychischen Erkrankungen werden.
Was speziell die Pollinose betrifft, so wurde sie weltweit bei 0,5–15% der Bevölkerung offiziell diagnostiziert.
In Deutschland geht man derzeit davon aus, dass etwa 15–20% der Menschen an Heuschnupfen leiden – Tendenz steigend. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen, da die Symptome (wie Rhinitis oder Konjunktivitis) oft unspezifisch sind und fälschlicherweise als wiederkehrende Erkältungen oder grippale Infekte interpretiert werden.
Viele Fälle werden daher nicht als Pollinose erfasst und fehlen in der offiziellen Statistik.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass mittlerweile mehr als 50% der Europäer in irgendeiner Form von Allergien betroffen sind. Allergische Erkrankungen könnten im Laufe des 21. Jahrhunderts weltweit zur zweithäufigsten Krankheitsgruppe nach psychischen Erkrankungen werden.
Was speziell die Pollinose betrifft, so wurde sie weltweit bei 0,5–15% der Bevölkerung offiziell diagnostiziert.
In Deutschland geht man derzeit davon aus, dass etwa 15–20% der Menschen an Heuschnupfen leiden – Tendenz steigend. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen, da die Symptome (wie Rhinitis oder Konjunktivitis) oft unspezifisch sind und fälschlicherweise als wiederkehrende Erkältungen oder grippale Infekte interpretiert werden.
Viele Fälle werden daher nicht als Pollinose erfasst und fehlen in der offiziellen Statistik.
🤧 Pollinose – Symptome & weniger bekannte Beschwerden
Die ersten Anzeichen einer Pollenallergie ähneln oft dem Beginn einer Erkältung oder Grippe. Doch die Ursachen und der Verlauf unterscheiden sich deutlich – und es lohnt sich, genauer hinzuschauen.
Pollinose oder doch Erkältung?
Viele verwechseln Pollinose mit einem grippalen Infekt. Hier hilft ein genauer Blick:
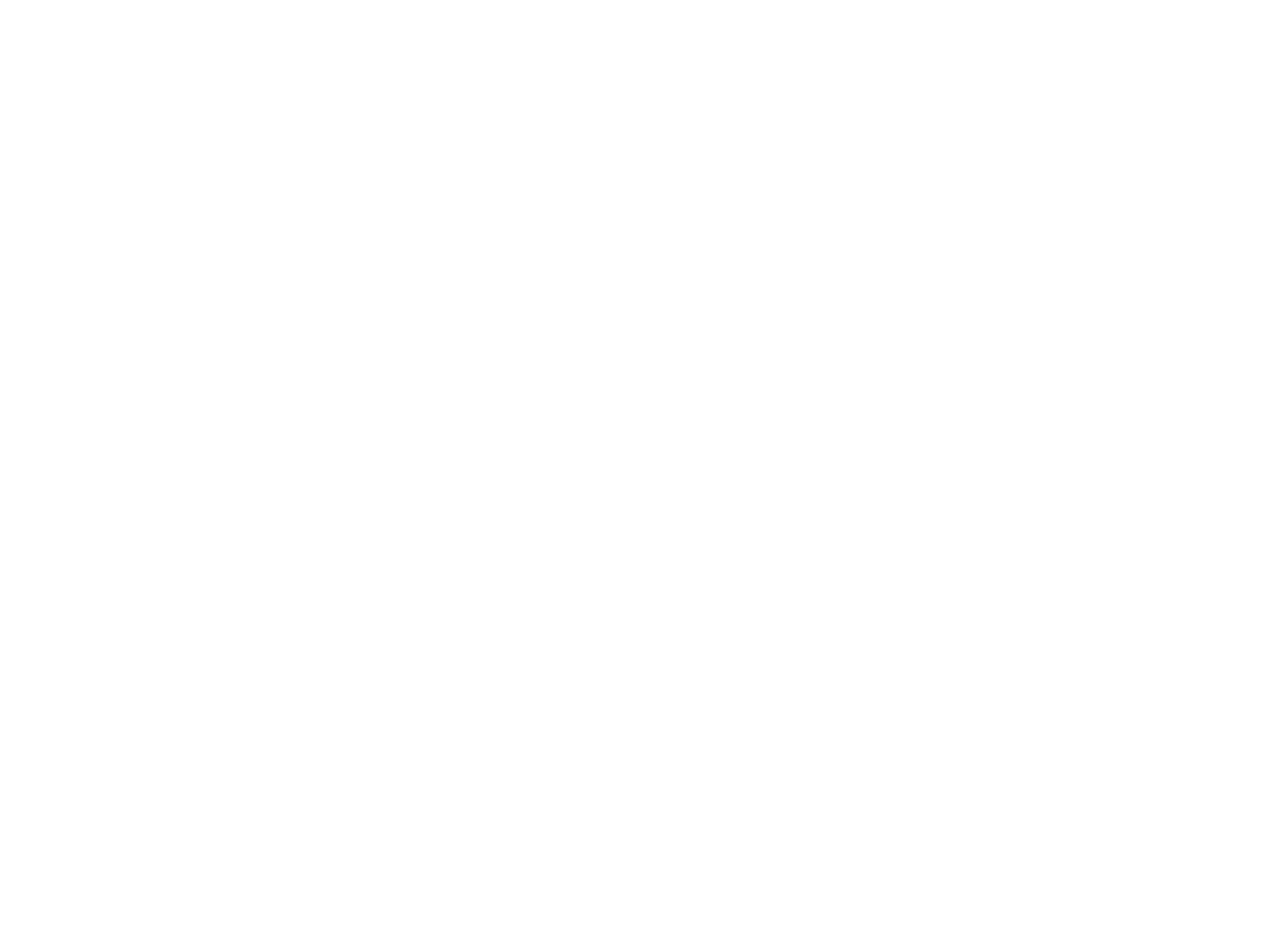
Das Nasensekret enthält häufig viele Eosinophile – Immunzellen, die typisch für allergische Reaktionen sind.
Durch das ständige Fließen kommt es zu Rötungen und Irritationen an Nasenflügeln und Oberlippe. Eine Schwellung der Schleimhaut kann Geruchsverlust und Hörprobleme verursachen.
Durch das ständige Fließen kommt es zu Rötungen und Irritationen an Nasenflügeln und Oberlippe. Eine Schwellung der Schleimhaut kann Geruchsverlust und Hörprobleme verursachen.
Wenn die Atemwege tiefer betroffen sind: Pollenasthma
Bei etwa 18% der Betroffenen kann sich die Allergie auf die Bronchien ausweiten. Es kommt zu Symptomen ähnlich wie bei Asthma bronchiale:
- Atemnot
- pfeifendes, erschwertes Atmen
- Engegefühl in der Brust
- trockener Husten, insbesondere nachts
Pollenintoxikation – die übersehene Belastung
Neben den bekannten Beschwerden kann Pollinose auch systemische Symptome hervorrufen – eine Art „Pollenvergiftung“:
- erhöhte Müdigkeit, Antriebslosigkeit
- Schlafstörungen
- Reizbarkeit, depressive Verstimmungen
- Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme
- Übelkeit, Erbrechen, starke Bauchschmerzen
- niedriger Blutdruck
- Tachykardie (schneller Herzschlag)
- Quincke-Ödem (Angioödem)
- Verschlechterung von Neurodermitis, Urtikaria (Nesselsucht)
Kinder und Pollinose: oft nicht erkannt
Bei Kindern zeigt sich Pollinose oft auf andere Weise:
- Weinerlichkeit
- übermäßiges Schwitzen
- Lernschwierigkeiten
- motorische Unruhe
- soziale Unsicherheit oder Rückzug
Vorsicht Kreuzreaktionen: Pollen & Nahrungsmittel
Pollenallergien stehen oft in Verbindung mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Der Grund: Ähnliche Eiweißstrukturen führen zu Kreuzreaktionen.
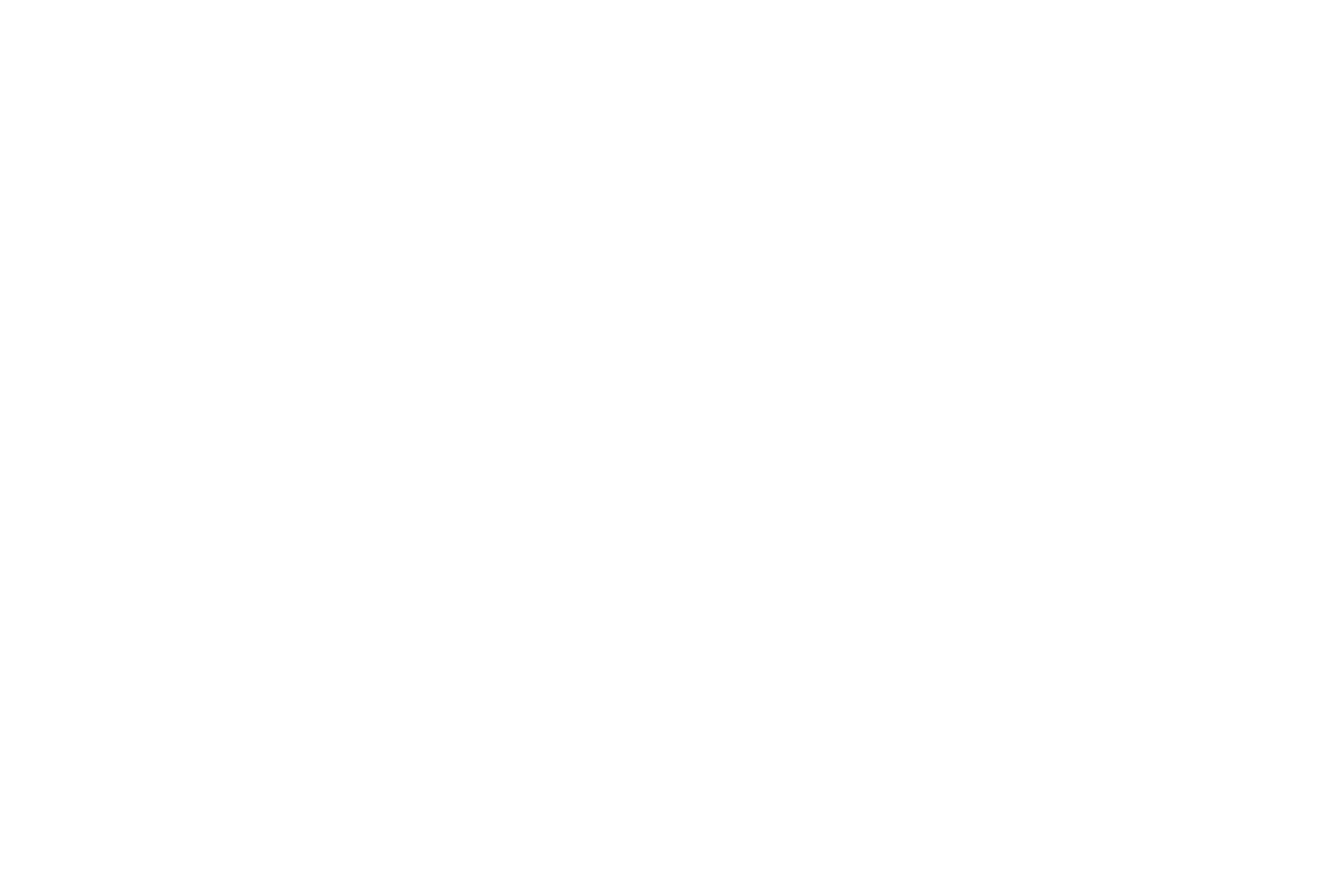
📅 Saisonalität der Pollinose – Verlauf und Einflussfaktoren
Pollinose ist eine klar saisonal bedingte Erkrankung, deren Auftreten mit der Blüte bestimmter Pflanzenarten verbunden ist.
Weltweit sind mehr als 700 Pflanzenarten identifiziert, deren Pollen allergen wirken können. Ein einzelnes Pollenkorn enthält in der Regel 5 bis 10 unterschiedliche Antigene. Die wasserlöslichen Fraktionen dieser Allergene wirken bevorzugt auf Schleimhäute, während fettlösliche Bestandteile Hautreaktionen wie kontaktekzemartige Dermatitis auslösen können.
Weltweit sind mehr als 700 Pflanzenarten identifiziert, deren Pollen allergen wirken können. Ein einzelnes Pollenkorn enthält in der Regel 5 bis 10 unterschiedliche Antigene. Die wasserlöslichen Fraktionen dieser Allergene wirken bevorzugt auf Schleimhäute, während fettlösliche Bestandteile Hautreaktionen wie kontaktekzemartige Dermatitis auslösen können.
Typische Belastungsphasen im Jahresverlauf
Die Hauptbelastungszeiten durch Pollen lassen sich in drei Phasen unterteilen:
- Frühjahrs-Peak (z. B. Hasel, Erle, Birke)
- Sommer-Peak (z. B. Gräser, Roggen, Ampfer)
- Herbst-Peak (z. B. Beifuß, Ambrosia)
Einfluss von Wetter und Tageszeit
Die Intensität der allergischen Reaktion steht in direktem Zusammenhang mit:
- der Pollenmenge in der Luft
- der Witterung
- der Tageszeit
- geringe Belastung bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Windstille
- hohe Belastung an trockenen, warmen und windigen Tagen
- zwischen 11:00 und 18:00 Uhr ihr Maximum
- zwischen 21:00 und 05:00 Uhr ihr Minimum
Erhöhtes Risiko in städtischen Gebieten
In urbanen Regionen adsorbieren Pollenpartikel häufig Luftschadstoffe wie Feinstaub oder Ozon. Diese „belasteten“ Pollen verstärken die Reizwirkung und führen zu intensiveren Symptomen.
Pollenflugkalender als wichtiges Hilfsmittel
Die Orientierung am regionalen Pollenflugkalender ist ein bewährtes Mittel zur Vorbeugung und Planung. Der Einsatz erfolgt in mehreren Bereichen:
- Terminplanung für Aufenthalte oder Reisen außerhalb der Hauptblütezeiten
- frühzeitiger Beginn präventiver Maßnahmen (z. B. medikamentöse oder ergänzende Unterstützung)
🧬 Ursachen der Pollinose und Empfehlungen für den Alltag
Die äußeren Symptome allergischer Erkrankungen wie Pollinose stehen häufig im Zusammenhang mit inneren Regulationsstörungen im Körper. Verschiedene funktionelle Schwächen oder Belastungen begünstigen das Auftreten allergischer Reaktionen.
Mögliche innere Ursachen
- ein geschwächtes Immunsystem oder eine überempfindliche Immunantwort
- chronische Belastung durch Umwelttoxine
- Störungen der neuroendokrinen Regulation – ein komplexes Zusammenspiel von Nervenimpulsen und hormonähnlichen Botenstoffen im Blut und in der Lymphe
Begünstigende Faktoren
- genetische Prädisposition
- hohe Umweltbelastung (z. B. Luftverschmutzung)
- bereits bestehende allergische Erkrankungen
- chronisch-entzündliche Prozesse in den Atemwegen
Verhaltensregeln im Alltag während der Pollensaison
Zur Verringerung der Allergenbelastung und zur besseren Verträglichkeit der Saison empfehlen sich folgende Maßnahmen:
- Bei windigem Wetter und in den frühen Morgenstunden möglichst keinen Aufenthalt im Freien einplanen.
- Die geringste Pollenbelastung wird nach Regen und am späten Abend beobachtet.
- Fenster geschlossen halten, Lüften idealerweise nach Niederschlägen.
- Klimaanlagen sollten mit Feinfiltern ausgestattet sein.
- Bei sehr starker Belastung kann ein vorübergehender Aufenthalt in einer pollenarmen Region sinnvoll sein.
- Auf Picknicks in der Natur sollte verzichtet werden.
- Kleidung häufig wechseln und waschen, insbesondere nach dem Aufenthalt im Freien.
- Nach dem Nachhausekommen: umziehen, Hände, Gesicht und Nase reinigen.
- Haare täglich waschen, da sich Pollen dort besonders gut ablagern.
- Eine hypoallergene Ernährung einhalten, um die Gesamtbelastung des Körpers zu reduzieren.
- Wichtige Ereignisse, wie z. B. Prüfungen oder Präsentationen, möglichst außerhalb der Pollensaison planen.
- Auf Impfungen und geplante operative Eingriffe sollte während der Hochsaison verzichtet werden.
🌿 Behandlung der Pollinose – konventionelle und natürliche Ansätze
Zur Therapie der Pollinose stehen in der Schulmedizin zwei Hauptstrategien zur Verfügung:
1. Allergenspezifische Immuntherapie (ASIT)
Dabei werden schrittweise steigende Dosen des identifizierten Allergens verabreicht.
Ziel ist die Bildung sogenannter blockierender IgG-Antikörper, die das Allergen neutralisieren, bevor es mit IgE-Antikörpern interagieren kann.
Dieser Prozess wird als Hyposensibilisierung bezeichnet und gilt insbesondere bei Kindern als wirksam.
Ziel ist die Bildung sogenannter blockierender IgG-Antikörper, die das Allergen neutralisieren, bevor es mit IgE-Antikörpern interagieren kann.
Dieser Prozess wird als Hyposensibilisierung bezeichnet und gilt insbesondere bei Kindern als wirksam.
2. Pharmakotherapie
Zum Einsatz kommen vier Hauptgruppen von Medikamenten:
Ein Beispiel: Allergodil (Wirkstoff Azelastin), erhältlich als Augentropfen oder Nasenspray, zugelassen zur Behandlung von saisonaler und ganzjähriger allergischer Rhinitis sowie Konjunktivitis.
Beobachtete Nebenwirkungen können sein:
- Antihistaminika
- Mastzellstabilisatoren
- abschwellende Präparate (Vasokonstriktoren)
- Glukokortikosteroide (bei schweren Verlaufsformen)
Ein Beispiel: Allergodil (Wirkstoff Azelastin), erhältlich als Augentropfen oder Nasenspray, zugelassen zur Behandlung von saisonaler und ganzjähriger allergischer Rhinitis sowie Konjunktivitis.
Beobachtete Nebenwirkungen können sein:
- Hautausschläge, Juckreiz, Nesselsucht
- Niesen, Husten, Pharyngitis, Atemnot, Bronchospasmen
- Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit
- Übelkeit, Appetitverlust, bitterer Geschmack, trockener Mund
- Tachykardie, Muskelschmerzen, Gewichtszunahme
- Reizungen und Blutungen der Nasenschleimhaut
- Augenreizungen, Sehstörungen, Hornhautveränderungen
🍃 Natürliche Alternativen und ganzheitliche Unterstützung mit Nature's-Sunshine-Produkten
Zur Linderung allergischer Symptome ist der alleinige Griff zu Medikamenten nicht zwingend erforderlich.
Ein ganzheitlicher Ansatz beinhaltet:
Ein ganzheitlicher Ansatz beinhaltet:
- eine Anpassung der Ernährung (frisch, ballaststoff- und enzymreich)
- gezielte Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen
- natürliche Unterstützung durch hochwertige pflanzliche Präparate
✅ Basisprogramm bei Pollenallergie
-
- Stabilisierung der Zellmembranen von Mastzellen
- Reduzierung der Histaminfreisetzung
- antientzündlich, abschwellend
- Förderung von Leber-, Nieren- und Pankreasfunktion
- Unterstützung der Entgiftung
-
- wirksames Detox-Mittel, innerlich anwendbar
- eignet sich auch zur Nasenspülung
-
- senkt die Zellpermeabilität für Allergene
- antiallergisch, vergleichbar mit Antihistaminika
- reduziert die Empfindlichkeit des Körpers gegenüber Allergenen
-
- Calcium stabilisiert Mastzellen durch Kalziumionen
- verhindert die Freisetzung von Histamin
- analog zur Notfallmedizin (Im Falle eines allergischen Schocks erfolgt in der Regel eine intravenöse Gabe von Calciumchlorid)
✅ Empfohlen zur Erweiterung des Programms
-
- eliminiert Reizstoffe aus dem Körper
- aktiviert Phagozyten (Fresszellen), die allergieauslösende Substanzen erkennen und abbauen
- unterstützt die Immunregulation und die Ausleitung von Allergenen
-
- entzündungshemmend
- reduziert allergische Reaktionen
-
- natürliches Antihistaminikum
- verhindert Histaminfreisetzung
-
- fördern eine gesunde Darmflora
- stärken das Immunsystem über die Darm-Immunschranke
-
- verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen
- unterstützt die körpereigene Abwehr
Wann sollte begonnen werden?
Die Einnahme der Präparate wird etwa 30 Tage vor dem erwarteten Beginn der Pollensaison empfohlen, um das Immunsystem rechtzeitig zu stabilisieren und auf den Kontakt mit Allergenen vorzubereiten.
Einnahmeempfehlungen
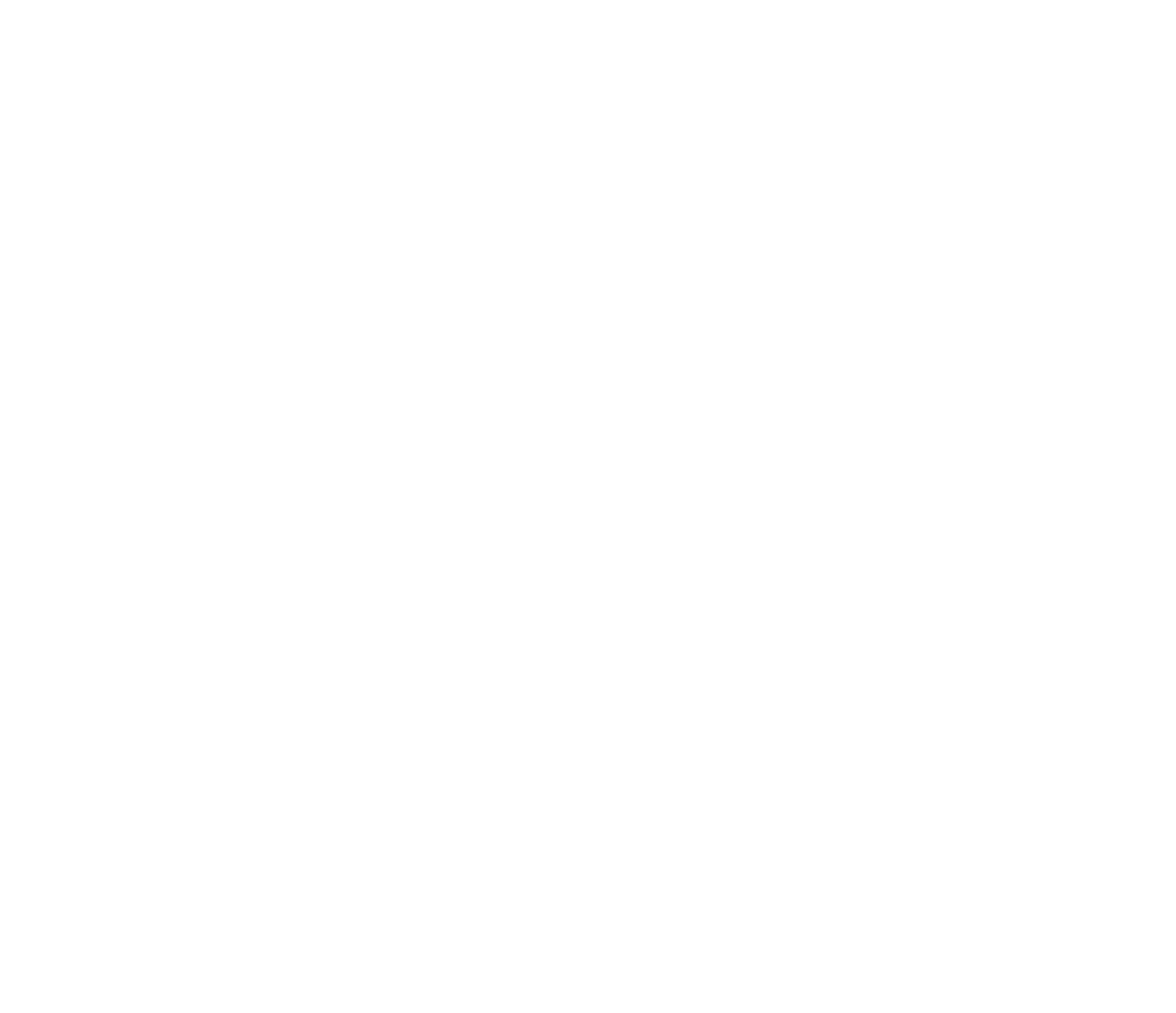
POLLINOSE
Auch bekannt als Heuschnupfen oder Pollenallergie
Symptome, Ursachen und Empfehlungen zur Behandlung
Die Pollenallergie (auch Heuschnupfen oder Pollinose genannt) gehört zu den häufigsten allergischen Erkrankungen weltweit und weist eine ausgeprägte saisonale Abhängigkeit auf. Sie tritt auf, wenn das Immunsystem überempfindlich auf Pollen von Pflanzen reagiert – insbesondere bei wiederholtem Kontakt.
Der Begriff „Pollinose“ stammt vom lateinischen Wort pollen, was „Blütenstaub“ bedeutet – also genau der Stoff, der die Reaktion im Körper auslöst. Synonyme sind Heuschnupfen, Pollenallergie oder eben Pollinose.
In rund 95% der Fälle äußert sich die Pollinose durch:
Der Begriff „Pollinose“ stammt vom lateinischen Wort pollen, was „Blütenstaub“ bedeutet – also genau der Stoff, der die Reaktion im Körper auslöst. Synonyme sind Heuschnupfen, Pollenallergie oder eben Pollinose.
In rund 95% der Fälle äußert sich die Pollinose durch:
- allergische Rhinitis: laufende oder verstopfte Nase, starker Nasenausfluss, Juckreiz in Nase und Gaumen, anfallsartiges Niesen
- allergische Konjunktivitis: gerötete Augen, Juckreiz und Schwellung der Augenlider, Tränenfluss
📊 Wie viele Menschen sind betroffen?
Laut aktueller globaler Statistiken leiden bis zu 40% der Weltbevölkerung an allergischen Erkrankungen – mit einer Verdopplung der Fallzahlen etwa alle 10 Jahre.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass mittlerweile mehr als 50% der Europäer in irgendeiner Form von Allergien betroffen sind. Allergische Erkrankungen könnten im Laufe des 21. Jahrhunderts weltweit zur zweithäufigsten Krankheitsgruppe nach psychischen Erkrankungen werden.
Was speziell die Pollinose betrifft, so wurde sie weltweit bei 0,5–15% der Bevölkerung offiziell diagnostiziert.
In Deutschland geht man derzeit davon aus, dass etwa 15–20% der Menschen an Heuschnupfen leiden – Tendenz steigend. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen, da die Symptome (wie Rhinitis oder Konjunktivitis) oft unspezifisch sind und fälschlicherweise als wiederkehrende Erkältungen oder grippale Infekte interpretiert werden.
Viele Fälle werden daher nicht als Pollinose erfasst und fehlen in der offiziellen Statistik.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass mittlerweile mehr als 50% der Europäer in irgendeiner Form von Allergien betroffen sind. Allergische Erkrankungen könnten im Laufe des 21. Jahrhunderts weltweit zur zweithäufigsten Krankheitsgruppe nach psychischen Erkrankungen werden.
Was speziell die Pollinose betrifft, so wurde sie weltweit bei 0,5–15% der Bevölkerung offiziell diagnostiziert.
In Deutschland geht man derzeit davon aus, dass etwa 15–20% der Menschen an Heuschnupfen leiden – Tendenz steigend. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen, da die Symptome (wie Rhinitis oder Konjunktivitis) oft unspezifisch sind und fälschlicherweise als wiederkehrende Erkältungen oder grippale Infekte interpretiert werden.
Viele Fälle werden daher nicht als Pollinose erfasst und fehlen in der offiziellen Statistik.
🤧 Pollinose – Symptome & weniger bekannte Beschwerden
Die ersten Anzeichen einer Pollenallergie ähneln oft dem Beginn einer Erkältung oder Grippe. Doch die Ursachen und der Verlauf unterscheiden sich deutlich – und es lohnt sich, genauer hinzuschauen.
Pollinose oder doch Erkältung?
Viele verwechseln Pollinose mit einem grippalen Infekt. Hier hilft ein genauer Blick:
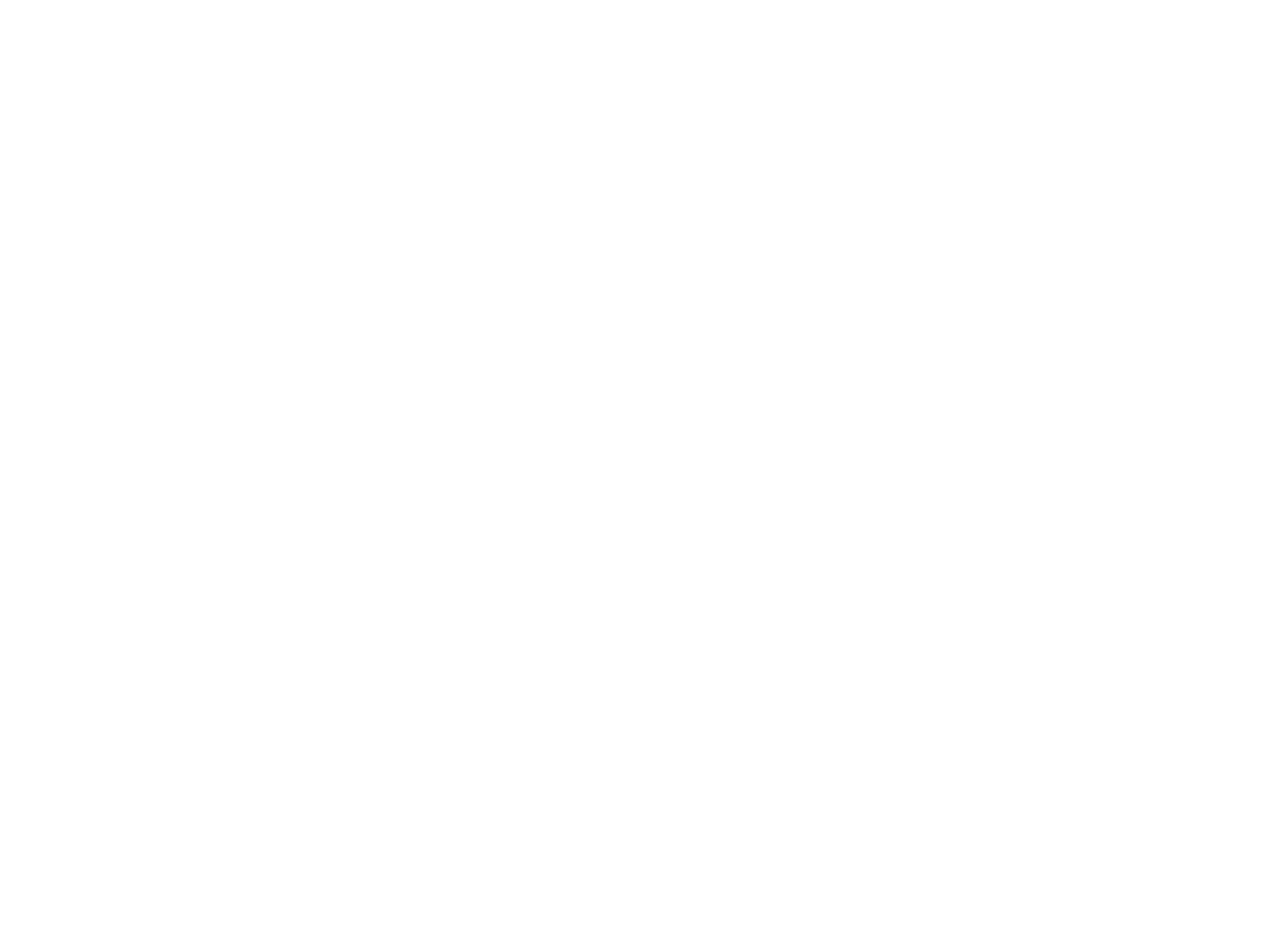
Das Nasensekret enthält häufig viele Eosinophile – Immunzellen, die typisch für allergische Reaktionen sind.
Durch das ständige Fließen kommt es zu Rötungen und Irritationen an Nasenflügeln und Oberlippe. Eine Schwellung der Schleimhaut kann Geruchsverlust und Hörprobleme verursachen.
Durch das ständige Fließen kommt es zu Rötungen und Irritationen an Nasenflügeln und Oberlippe. Eine Schwellung der Schleimhaut kann Geruchsverlust und Hörprobleme verursachen.
Wenn die Atemwege tiefer betroffen sind: Pollenasthma
Bei etwa 18% der Betroffenen kann sich die Allergie auf die Bronchien ausweiten. Es kommt zu Symptomen ähnlich wie bei Asthma bronchiale:
- Atemnot
- pfeifendes, erschwertes Atmen
- Engegefühl in der Brust
- trockener Husten, insbesondere nachts
Pollenintoxikation – die übersehene Belastung
Neben den bekannten Beschwerden kann Pollinose auch systemische Symptome hervorrufen – eine Art „Pollenvergiftung“:
- erhöhte Müdigkeit, Antriebslosigkeit
- Schlafstörungen
- Reizbarkeit, depressive Verstimmungen
- Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme
- Übelkeit, Erbrechen, starke Bauchschmerzen
- niedriger Blutdruck
- Tachykardie (schneller Herzschlag)
- Quincke-Ödem (Angioödem)
- Verschlechterung von Neurodermitis, Urtikaria (Nesselsucht)
Kinder und Pollinose: oft nicht erkannt
Bei Kindern zeigt sich Pollinose oft auf andere Weise:
- Weinerlichkeit
- übermäßiges Schwitzen
- Lernschwierigkeiten
- motorische Unruhe
- soziale Unsicherheit oder Rückzug
Vorsicht Kreuzreaktionen: Pollen & Nahrungsmittel
Pollenallergien stehen oft in Verbindung mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Der Grund: Ähnliche Eiweißstrukturen führen zu Kreuzreaktionen.
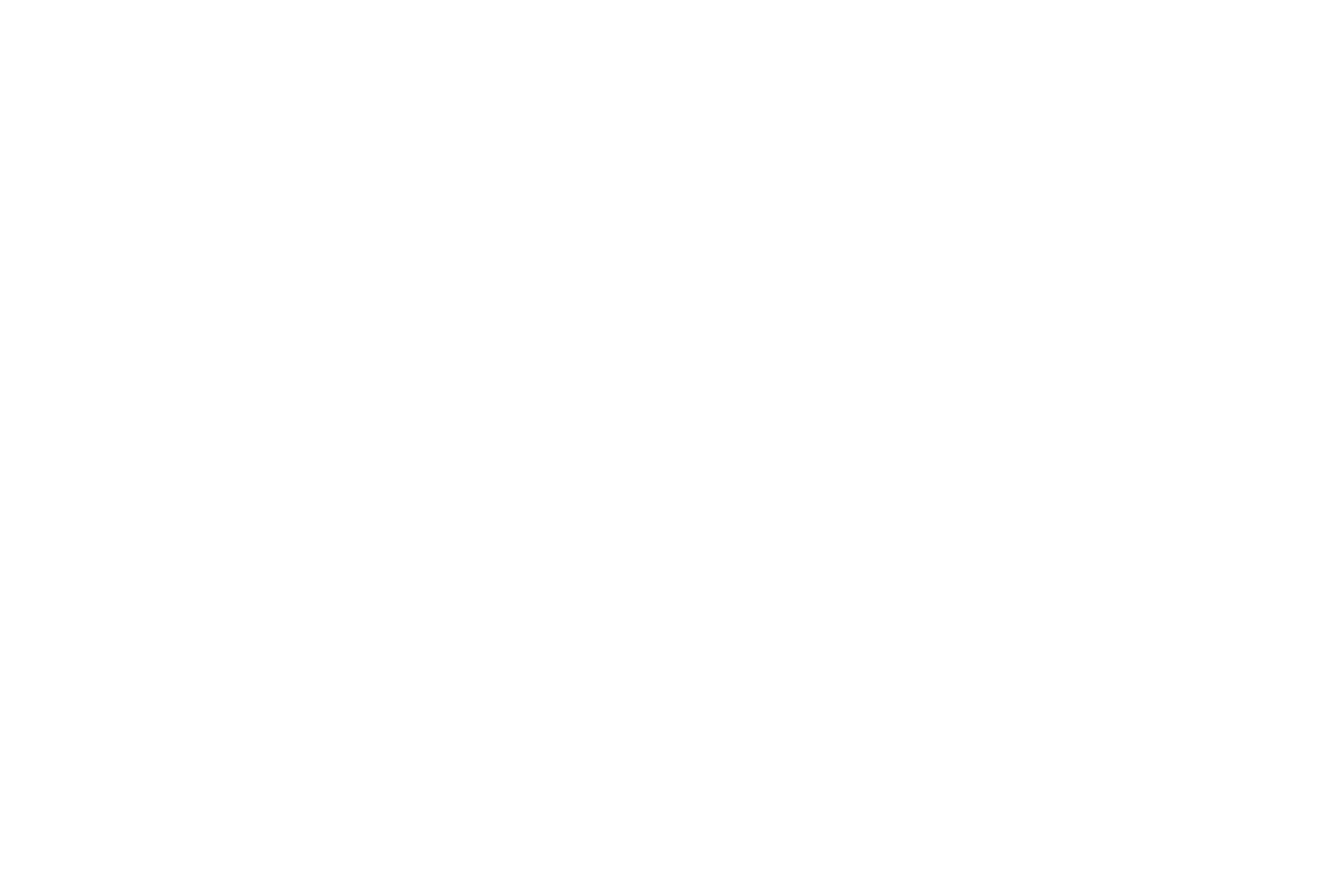
📅 Saisonalität der Pollinose – Verlauf und Einflussfaktoren
Pollinose ist eine klar saisonal bedingte Erkrankung, deren Auftreten mit der Blüte bestimmter Pflanzenarten verbunden ist.
Weltweit sind mehr als 700 Pflanzenarten identifiziert, deren Pollen allergen wirken können. Ein einzelnes Pollenkorn enthält in der Regel 5 bis 10 unterschiedliche Antigene. Die wasserlöslichen Fraktionen dieser Allergene wirken bevorzugt auf Schleimhäute, während fettlösliche Bestandteile Hautreaktionen wie kontaktekzemartige Dermatitis auslösen können.
Weltweit sind mehr als 700 Pflanzenarten identifiziert, deren Pollen allergen wirken können. Ein einzelnes Pollenkorn enthält in der Regel 5 bis 10 unterschiedliche Antigene. Die wasserlöslichen Fraktionen dieser Allergene wirken bevorzugt auf Schleimhäute, während fettlösliche Bestandteile Hautreaktionen wie kontaktekzemartige Dermatitis auslösen können.
Typische Belastungsphasen im Jahresverlauf
Die Hauptbelastungszeiten durch Pollen lassen sich in drei Phasen unterteilen:
- Frühjahrs-Peak (z. B. Hasel, Erle, Birke)
- Sommer-Peak (z. B. Gräser, Roggen, Ampfer)
- Herbst-Peak (z. B. Beifuß, Ambrosia)
Einfluss von Wetter und Tageszeit
Die Intensität der allergischen Reaktion steht in direktem Zusammenhang mit:
- der Pollenmenge in der Luft
- der Witterung
- der Tageszeit
- geringe Belastung bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Windstille
- hohe Belastung an trockenen, warmen und windigen Tagen
- zwischen 11:00 und 18:00 Uhr ihr Maximum
- zwischen 21:00 und 05:00 Uhr ihr Minimum
Erhöhtes Risiko in städtischen Gebieten
In urbanen Regionen adsorbieren Pollenpartikel häufig Luftschadstoffe wie Feinstaub oder Ozon. Diese „belasteten“ Pollen verstärken die Reizwirkung und führen zu intensiveren Symptomen.
Pollenflugkalender als wichtiges Hilfsmittel
Die Orientierung am regionalen Pollenflugkalender ist ein bewährtes Mittel zur Vorbeugung und Planung. Der Einsatz erfolgt in mehreren Bereichen:
- Terminplanung für Aufenthalte oder Reisen außerhalb der Hauptblütezeiten
- frühzeitiger Beginn präventiver Maßnahmen (z. B. medikamentöse oder ergänzende Unterstützung)
🧬 Ursachen der Pollinose und Empfehlungen für den Alltag
Die äußeren Symptome allergischer Erkrankungen wie Pollinose stehen häufig im Zusammenhang mit inneren Regulationsstörungen im Körper. Verschiedene funktionelle Schwächen oder Belastungen begünstigen das Auftreten allergischer Reaktionen.
Mögliche innere Ursachen
- ein geschwächtes Immunsystem oder eine überempfindliche Immunantwort
- chronische Belastung durch Umwelttoxine
- Störungen der neuroendokrinen Regulation – ein komplexes Zusammenspiel von Nervenimpulsen und hormonähnlichen Botenstoffen im Blut und in der Lymphe
Begünstigende Faktoren
- genetische Prädisposition
- hohe Umweltbelastung (z. B. Luftverschmutzung)
- bereits bestehende allergische Erkrankungen
- chronisch-entzündliche Prozesse in den Atemwegen
Verhaltensregeln im Alltag während der Pollensaison
Zur Verringerung der Allergenbelastung und zur besseren Verträglichkeit der Saison empfehlen sich folgende Maßnahmen:
- Bei windigem Wetter und in den frühen Morgenstunden möglichst keinen Aufenthalt im Freien einplanen.
- Die geringste Pollenbelastung wird nach Regen und am späten Abend beobachtet.
- Fenster geschlossen halten, Lüften idealerweise nach Niederschlägen.
- Klimaanlagen sollten mit Feinfiltern ausgestattet sein.
- Bei sehr starker Belastung kann ein vorübergehender Aufenthalt in einer pollenarmen Region sinnvoll sein.
- Auf Picknicks in der Natur sollte verzichtet werden.
- Kleidung häufig wechseln und waschen, insbesondere nach dem Aufenthalt im Freien.
- Nach dem Nachhausekommen: umziehen, Hände, Gesicht und Nase reinigen.
- Haare täglich waschen, da sich Pollen dort besonders gut ablagern.
- Eine hypoallergene Ernährung einhalten, um die Gesamtbelastung des Körpers zu reduzieren.
- Wichtige Ereignisse, wie z. B. Prüfungen oder Präsentationen, möglichst außerhalb der Pollensaison planen.
- Auf Impfungen und geplante operative Eingriffe sollte während der Hochsaison verzichtet werden.
🌿 Behandlung der Pollinose – konventionelle und natürliche Ansätze
Zur Therapie der Pollinose stehen in der Schulmedizin zwei Hauptstrategien zur Verfügung:
1. Allergenspezifische Immuntherapie (ASIT)
Dabei werden schrittweise steigende Dosen des identifizierten Allergens verabreicht.
Ziel ist die Bildung sogenannter blockierender IgG-Antikörper, die das Allergen neutralisieren, bevor es mit IgE-Antikörpern interagieren kann.
Dieser Prozess wird als Hyposensibilisierung bezeichnet und gilt insbesondere bei Kindern als wirksam.
Ziel ist die Bildung sogenannter blockierender IgG-Antikörper, die das Allergen neutralisieren, bevor es mit IgE-Antikörpern interagieren kann.
Dieser Prozess wird als Hyposensibilisierung bezeichnet und gilt insbesondere bei Kindern als wirksam.
2. Pharmakotherapie
Zum Einsatz kommen vier Hauptgruppen von Medikamenten:
Ein Beispiel: Allergodil (Wirkstoff Azelastin), erhältlich als Augentropfen oder Nasenspray, zugelassen zur Behandlung von saisonaler und ganzjähriger allergischer Rhinitis sowie Konjunktivitis.
Beobachtete Nebenwirkungen können sein:
- Antihistaminika
- Mastzellstabilisatoren
- abschwellende Präparate (Vasokonstriktoren)
- Glukokortikosteroide (bei schweren Verlaufsformen)
Ein Beispiel: Allergodil (Wirkstoff Azelastin), erhältlich als Augentropfen oder Nasenspray, zugelassen zur Behandlung von saisonaler und ganzjähriger allergischer Rhinitis sowie Konjunktivitis.
Beobachtete Nebenwirkungen können sein:
- Hautausschläge, Juckreiz, Nesselsucht
- Niesen, Husten, Pharyngitis, Atemnot, Bronchospasmen
- Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit
- Übelkeit, Appetitverlust, bitterer Geschmack, trockener Mund
- Tachykardie, Muskelschmerzen, Gewichtszunahme
- Reizungen und Blutungen der Nasenschleimhaut
- Augenreizungen, Sehstörungen, Hornhautveränderungen
🍃 Natürliche Alternativen und ganzheitliche Unterstützung mit Nature's-Sunshine-Produkten
Zur Linderung allergischer Symptome ist der alleinige Griff zu Medikamenten nicht zwingend erforderlich.
Ein ganzheitlicher Ansatz beinhaltet:
Ein ganzheitlicher Ansatz beinhaltet:
- eine Anpassung der Ernährung (frisch, ballaststoff- und enzymreich)
- gezielte Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen
- natürliche Unterstützung durch hochwertige pflanzliche Präparate
✅ Basisprogramm bei Pollenallergie
- Breathe Clear – pflanzliches Antihistaminikum
- Stabilisierung der Zellmembranen von Mastzellen
- Reduzierung der Histaminfreisetzung
- antientzündlich, abschwellend
- Förderung von Leber-, Nieren- und Pankreasfunktion
- Unterstützung der Entgiftung
-
- wirksames Detox-Mittel, innerlich anwendbar
- eignet sich auch zur Nasenspülung
-
- senkt die Zellpermeabilität für Allergene
- antiallergisch, vergleichbar mit Antihistaminika
- reduziert die Empfindlichkeit des Körpers gegenüber Allergenen
-
- Calcium stabilisiert Mastzellen durch Kalziumionen
- verhindert die Freisetzung von Histamin
- analog zur Notfallmedizin (Im Falle eines allergischen Schocks erfolgt in der Regel eine intravenöse Gabe von Calciumchlorid)
✅ Empfohlen zur Erweiterung des Programms
-
- eliminiert Reizstoffe aus dem Körper
- aktiviert Phagozyten (Fresszellen), die allergieauslösende Substanzen erkennen und abbauen
- unterstützt die Immunregulation und die Ausleitung von Allergenen
-
- entzündungshemmend
- reduziert allergische Reaktionen
-
- natürliches Antihistaminikum
- verhindert Histaminfreisetzung
- Es wurde nachgewiesen, dass die tägliche Einnahme von 2 g Vitamin C über eine Woche den Histaminspiegel bei Erwachsenen um 38% senken kann.
-
- fördern eine gesunde Darmflora
- stärken das Immunsystem über die Darm-Immunschranke
-
- verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen
- unterstützt die körpereigene Abwehr
Wann sollte begonnen werden?
Die Einnahme der Präparate wird etwa 30 Tage vor dem erwarteten Beginn der Pollensaison empfohlen, um das Immunsystem rechtzeitig zu stabilisieren und auf den Kontakt mit Allergenen vorzubereiten.
Einnahmeempfehlungen